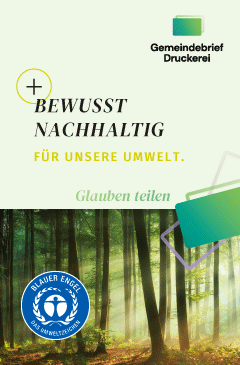Ein Erfahrungsbericht eines Jugendlichen, der von Sucht betroffen ist
„Hallo“, sage ich mit nervöser Stimme. Im Laufe der nächsten 50 Minuten wird es bei diesem einen Wort bleiben. Was soll ich denn auch sagen? Meine Diagnose lässt mich wie einen verkümmerten Drogenabhängigen wirken. Jahrelang dachte ich, ich wäre einfach nur ein bisschen anders und dann, auf einmal, der Schlag ins Gesicht. „Sie haben ein Suchtproblem“, sagte mein Therapeut mir in der ersten Sitzung. Zuerst dachte ich, er wolle mich für dumm verkaufen. Weswegen sollte ich denn sonst seit 15 Minuten still vor ihm sitzen? Jetzt sitze ich auf diesem viel zu harten Sessel und würde vor Scham am liebsten im Erdboden versinken. Doch der Raum um mich herum bleibt wie er ist. Ein klein bisschen Panik überkommt mich. Was, wenn ich mehr als „nur“ ein Suchtproblem habe? Was wenn ich wirklich anders bin? Was wenn meine Psyche nicht kaputt, sondern anders, schlechter, falsch ist? Vielleicht habe ich kein Suchtproblem, vielleicht bin ich das Problem.
„Mach dir nicht so einen Kopf“, meint ein Freund zu mir. Ich wäre ganz anders als ich immer sage. Ich wäre kein hoffnungsloser Fall, sondern es hätte sich schon so viel bei mir verändert. Es gehe aufwärts und zwar steil. Mein Freund versteht nicht, dass ich mich nie dafür entschieden habe, ein „abnormales“ und unglückliches Leben zu führen. Es geht mir nicht um Mitleid oder Zuspruch, um Relativierung oder Aufwägungen. Mein Freund fügt noch hinzu: „Das ist doch alles nicht so schlimm“. Doch für mich ist es schlimm. Es ist schlimm, jedes Mal, wenn ich einen Rückfall habe. Es ist nicht egal, wenn ich mich mal nicht zurückhalten kann. Es macht einen riesigen Unterschied ob ich zehn oder elf Tage keinen Rückfall hatte und ob der Rückfall kurz oder lang dauerte, ob ich mich gar nicht halten konnte oder ob es „nur“ eine kleine Kostprobe war. All das ist nicht „egal“ oder „halb so schlimm“. Ich verstehe, warum mein Freund mich beruhigen will, warum er mir sagt, dass unsere Freundschaft trotzdem besteht. Aber eben das belastet mich: Das mein Freund mir bestätigen muss, dass unsere Freundschaft trotz meines Entzugs Bestand hat, dass ich jeden Mittwoch in einem roten Ledersessel im Büro eines Therapeuten Platz nehmen muss, dass nichts in meinem Leben so läuft, wie ich es gerne hätte.
Ich setze mich neben meinen Freund und versuche ihm all das zu erzählen, was ich mich nicht mal meinem Therapeuten traue zu sagen. Ich erzähle ihm von meinen Gedanken, meinen Ängsten, meiner Verzweiflung. Selbstverständlich nicht direkt. Ich stottere, verhaspele mich, springe zurück und vermeide konsequent das „Ich“. Die anfängliche Überschwänglichkeit und Erleichterung, die ersten Zweifel, ob man vielleicht ein ernsthaftes Problem hat, die Floskeln, die man sich einredete, um sich das eigene Versagen nicht eingestehen zu müssen, die vielen Tiefpunkte, das Lachen auf Partys. Momenten, in denen man sich am liebsten alleine auf seinem Bett zusammengekauert hätte. All diese Momente, in denen ich nicht war wie die Anderen. Nach ein paar Minuten voller „das klingt dumm, aber“, „ich weiß, dass das blöd ist“, „versteh mich nicht falsch“, gemischt mit vielen Tränen und zerkauten Nägeln, spüre ich plötzlich die Hand meines Freundes auf meiner Schulter.
Mein Therapeut sagt immer: „Wenn Sie nicht reden, kann ich Ihnen nicht helfen“. Ich habe sehr lange gebraucht, um diesen Satz zu verstehen. Zu Beginn fand ich ihn überheblich. Als hätte der Mann mir gegenüber ein Recht darauf, dass ich meine innersten Gefühle und Gedanken mit ihm teile. Ich rutschte in die Defensive, erzählte nur die halbe Wahrheit. Wenn überhaupt. Mit der Zeit wich diese Barrikade langsam auf und auf einmal wurde mein Leben besser. Keine Frage, das meiste blieb ein ziemlich kaputter Haufen, aber auf einmal gab es kurze Momente des Glücks. So klein, dass sie schneller weg waren, als dass ich es mit jemandem hätte teilen können und doch ein Zeichen dafür, dass da mehr in mir steckt als nur ein unkontrollierbares Monster. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass die Sucht da ist. Dass sie nicht weg zu schweigen ist; dass die jahrelangen Ausweichmanöver alles nur noch schlimmer gemacht haben. Reden hilft. Nicht, weil man dadurch weniger süchtig ist, sondern weil die Psyche dadurch endlich den Raum bekommt, der ihr zusteht. Wenn einem auf einmal alles zu viel wird, kleinste Motive schon unfassbar starke Trigger sein können und man sich alleine und hilflos fühlt, dann kann mein Therapeut mir helfen. Mir kam einfach nicht in den Sinn, dass da jemand sitzt, der sich für mich interessiert, der mir zuhört, der mir wirklich helfen möchte.
Ich habe nicht die Kraft, mich alleine aus meinen Mustern zu befreien. Wenn in deinen Gedanken die ganze Welt gegen dich ist, kannst du so viel kämpfen wie du willst. Ich gegen alles andere – das klappt nicht. Ich bin in einem Spiel gefangen, dass ich nie gewinnen kann. Anstatt verzweifelt am Gewinnen festzuhalten, muss ich die Spielregeln ändern. Denn mein Leben spielt ausschließlich nach meinen Regeln.
Anonym, In: Pfarrbriefservice.de
Datei-Info:
Dateiformat: .rtf
Dateigröße: 0,05 MB
Sie dürfen diesen Text für alle nichtkommerziellen Zwecke der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pfarr-/Gemeindebrief, Plakat, Flyer, Website) sowie für Unterrichtszwecke* nutzen. Die Nutzung ist in dem beschriebenen Rahmen honorarfrei. Sie verpflichten sich den Namen des Autors/-in, als Quelle Pfarrbriefservice.de und ggf. weitere Angaben zu nennen.
*) Ausführliche Infos zu unseren Nutzungsbedingungen finden Sie hier.
Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegs an die Redaktionsanschrift.
Beispiel für den Urhebernachweis, den Sie führen müssen, wenn Sie den Text nutzen
Text: AnonymIn: Pfarrbriefservice.de