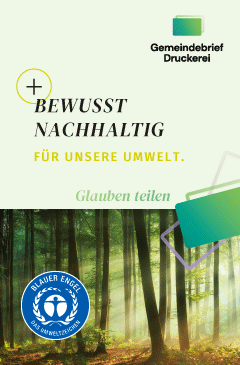„Die Suizidbeihilfe darf sich nicht zu einer normalen Option entwickeln“
Ein Interview mit der katholischen Moraltheologin Kerstin Schlögl-Flierl
Im Februar 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt und dass man dafür auch Hilfe in Anspruch nehmen darf. Seitdem ist die Frage einer Beihilfe zum Suizid wieder Gegenstand der gesellschaftlichen und parlamentarischen Debatte. 2015 hatte der Gesetzgeber eine organisierte Beihilfe, etwa durch Sterbehilfevereine, noch verboten. Diese Regelung erklärte das Bundesverfassungsgericht 2020 für verfassungswidrig. Die katholische Kirche ist gegen eine Beihilfe zum Suizid. Im Interview erklärt Kerstin Schlögl-Flierl die Beweggründe und setzt sich stattdessen für eine stärkere Suizidprävention ein. Die Professorin ist katholische Moraltheologin und Mitglied des Deutschen Ethikrates.
Frau Schlögl-Flierl, was spricht für Sie am stärksten gegen eine Beihilfe zum Suizid?
Kerstin Schlögl-Flierl: Sobald die Beihilfe zum Suizid als eine normale Dienstleistung angeboten würde, kann sie den Eindruck eines scheinbar einfachen Auswegs aus einer hilfebedürftigen Situation erwecken. Es würde zu einer Normalisierung kommen. Dadurch könnten vor allem die vulnerablen Gruppen, wie pflegebedürftige oder alte Menschen, unter sozialen Druck geraten, den Suizid zu wählen. Das darf auf keinen Fall geschehen. Vielmehr muss es darum gehen, Hilfe im Sterben zu leisten, also den hospizlichen und palliativen Ansatz zu stärken, das heißt bei den betroffenen Menschen zu bleiben, ihnen Hilfe anzubieten und sie zu begleiten.
In einem Zeitungsbeitrag bezeichneten Sie den Suizid als Hoffnungsabsage an Gott, an andere, aber auch an sich selbst. Was meinen Sie damit?
Kerstin Schlögl-Flierl: Lange Zeit ist der Suizid von der katholischen Kirche als Todsünde gesehen worden. Suizid ist allerdings ein sehr komplexes Phänomen. Wir haben uns in der Moraltheolog:innenschaft lange überlegt, was der Suizid denn überhaupt ist, welche Ausdruckshandlung dahinter steckt. Wenn man von der Sinnhaftigkeit des Lebens ausgeht, stellt der Suizid eine Hoffnungsabsage dar, die der Suizident, die Suizidentin in einer wirklich schwierigen Situation ausspricht. Die Hoffnungslosigkeit steht dann im Vordergrund.
Das heißt, christlich gedeutet, man traut Gott nicht mehr zu, dass er hilft und handelt.
Kerstin Schlögl-Flierl: Das kirchliche Verständnis von Selbstbestimmung ist dreifach angelegt: Selbstbestimmung in Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zu Gott. Ein Suizid bringt zum Ausdruck, dass man weder sich selbst, noch anderen und Gott zutraut, noch Hoffnung zu schenken. Wir wissen nicht, wie Gott den Suizidenten, die Suizidentin beurteilt. Darum geht es auch gar nicht bei dem Begriff der Hoffnungsabsage. Vielmehr ist er der Versuch, diese Ausdruckshandlung in Worte zu fassen und von der Sündensprache wegzukommen.
Einige evangelische Theologen argumentieren, der Wunsch, das Leben zu beenden, könne auch Ausdruck dafür sein, den Tod letztlich zu akzeptieren.
Kerstin Schlögl-Flierl: Da kommen wir wieder zu den schwierigen Fragen: Wem sind wir verantwortlich und wer kann uns helfen? Meiner Meinung nach müssen wir die Frage nach Suizid und Suizidbeihilfe in einen größeren Zusammenhang stellen, wie es auch der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme vom September 2022 getan hat. Es muss uns vor allem um die Stärkung der Suizidprävention gehen, die breit angelegt sein muss und auf verschiedenen Ebenen ansetzt, zum Beispiel bereits im Schulunterricht oder auch bei baulichen Maßnahmen. Da geht es dann nicht so sehr um die Frage: Darf er oder sie das tun? Erst muss die Gesellschaft alle Möglichkeiten der Suizidprävention ausschöpfen, um dann überhaupt erst zur Suizidbeihilfe zu kommen. Ich sehe da noch viel Nachholbedarf.
2022 untersuchten zwei Studien im Bistum Essen, wie verschiedene Berufsgruppen in christlichen Einrichtungen die Frage des assistierten Suizids bewerten. 40 Prozent können sich demnach eine Suizidbeihilfe vorstellen, 15 Prozent halten sie sogar für christlich geboten und weitere 30 Prozent können sie sich in Ausnahmefällen vorstellen. Nur 10 Prozent lehnen Suizidbeihilfe in christlichen Kontexten grundsätzlich ab. Zeigen diese Ergebnisse ein Auseinanderklaffen von Theorie und Praxis?
Kerstin Schlögl-Flierl: Es wird die Frage des laufenden Gesetzgebungsverfahrens sein, eine Balance zu finden, die eine Normalisierung des Suizids verhindert, aber auch den Einzelfällen Rechnung trägt. Hier steckt der sprichwörtliche Teufel im Detail. Die Frage ist doch: Wird Suizidbeihilfe als eine normale Option in einem christlichen Pflegeheim eröffnet oder sagt man: Grundsätzlich bieten wir keine Suizidbeihilfe an und halten sie nicht für wünschenswert; aber sollte in Einzelfällen andauernd und ernsthaft der Wunsch danach geäußert werden, sollte das unter Einbeziehung von Heimleitung, Pflegepersonal und Zu- und Angehörigen ermöglicht werden. Oder sagt das Pflegeheim als Gemeinschaft: Für uns ist das kein Weg und das kommunizieren wir auch so nach außen. Mir ist es wichtig, dass sich die Suizidbeihilfe nicht zu einer normalen Option entwickelt.
Das heißt aber auch, der langanhaltende Wunsch eines Menschen nach dem Tod sollte respektiert werden?
Kerstin Schlögl-Flierl: Ich würde sagen, der Wille ist zu respektieren, wenn alles unternommen worden ist, um den Suizid abzuwenden. Ich hoffe, dass es mit dem neuen Gesetz genügend Beratungsleistungen und genügend Begutachtungsverfahren geben wird, damit das, was vielleicht noch gar nicht auf dem Tisch lag, auf den Tisch kommen kann und die Lebensbindungen nochmal gestärkt werden. Wenn aber jemand nach diesem ganzen Prozess, der jetzt angedacht ist, wirklich bei seinem Wunsch bleibt, ist es sehr schwierig, ihm zu sagen: Nein, es ist dir nicht erlaubt.
Interview: Elfriede Klauer, In: Pfarrbriefservice.de
Datei-Info:
Dateiformat: .rtf
Dateigröße: 0,02 MB
Sie dürfen diesen Text für alle nichtkommerziellen Zwecke der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pfarr-/Gemeindebrief, Plakat, Flyer, Website) sowie für Unterrichtszwecke* nutzen. Die Nutzung ist in dem beschriebenen Rahmen honorarfrei. Sie verpflichten sich den Namen des Bildautors/-in, als Quelle Pfarrbriefservice.de und ggf. weitere Angaben zu nennen.
*) Ausführliche Infos zu unseren Nutzungsbedingungen finden Sie hier.
Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegs an die Redaktionsanschrift.
Beispiel für den Urhebernachweis, den Sie führen müssen, wenn Sie den Text nutzen
Text: Elfriede KlauerIn: Pfarrbriefservice.de