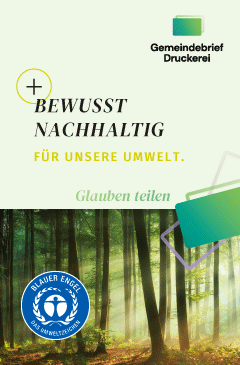„Wir befinden uns in einer Umbruchsituation“
Ein Interview mit Marita Wagner von missio Aachen über Alltagsrassismus
Zwei Jahre theologisches Studium in Südafrika haben Marita Wagner hautnah erleben lassen, dass Hautfarbe eine große Rolle spielt. Als weiße Europäerin stand sie zwischen den südafrikanischen weißen und Schwarzen Menschen und war herausgefordert, sich ihres eigenen Weißseins und der damit verbundenen Privilegien aufgrund einer 500jährigen Unterdrückungsgeschichte bewusst zu werden. Ihre Schwarzen Kommiliton:innen erlebte sie als offen und interessiert, aber auch teilweise mit einer gewissen Skepsis gegenüber weißen Menschen. Bei einigen weißen Student:innen merkte sie, wie „viele Denkmuster überlebt haben, wonach theoretisch alle Menschen gleich sind, aber dennoch einige Menschen gleicher und höherwertiger sind als andere“, berichtet sie. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus und wie man etwas dagegen tun kann.
Das Schlimme am Alltagsrassismus ist: Man verhält sich rassistisch, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Fällt Ihnen da von sich ein Beispiel ein?
Marita Wagner: Die Tatsache, dass ich in Südafrika studiert habe und mich seit einigen Jahren mit Rassismus und Postkolonialismus beschäftige, heißt nicht, dass ich immun gegen rassistische Denkmuster bin. Absolut nicht. Rassismus ist ein System, das sich über 500 Jahre globalisiert und institutionalisiert hat, das bekomme ich nicht innerhalb weniger Jahre aus meinem Denken raus. Ich bin da auch auf einer Reise und muss mich immer wieder selbst kritisch hinterfragen. Ein Beispiel, wo ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, aber in unbewussten Momenten passiert es mir eben auch: Vor einigen Wochen war ich zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, die Kopfhörer im Ohr, weil ich noch einen Podcast hören wollte. Ich hatte mich für ein Interview zurecht gemacht. Da kam mir eine Schwarze Frau entgegen. Ich habe sie nur halb wahrgenommen. Sie hob die Hand und wollte mich ansprechen. Für eine Millisekunde habe ich gedacht, sie wird mich wahrscheinlich fragen, ob ich etwas Kleingeld für sie habe. Und ich nehme die Kopfhörer raus und sage: „Entschuldigung, was kann ich für Sie tun?“ Sie antwortete: „Entschuldigen Sie, wenn ich Sie auf Ihrem Weg unterbreche. Ich habe Sie gesehen und wollte Ihnen sagen, dass Sie richtig toll aussehen. Ich wollte Ihnen einfach das Kompliment gerne aussprechen.“ Für diese Millisekunde, in der ich dachte, sie bittet mich um Kleingeld, habe ich mich danach wirklich geschämt. Diese Begebenheit ging mir den ganzen Tag sehr nach. Sie zeigte mir, dass ich bei weitem nicht da bin, wo ich sein möchte. Aber die Tatsache, dass ich es erkennen und benennen kann, das finde ich ganz wichtig. Da hat mir meine Zeit in Südafrika und meine Beschäftigung mit diesem Thema viel geholfen, dass ich Begrifflichkeiten und Theorien dazu kenne, die diese Phänomene analysieren und mir helfen, mich selbst kritisch in den Blick zu nehmen. Das ist für mich auch ein Trost, hier weiter voranzuschreiten. Es geht nicht darum, dass wir uns alle selbst geißeln und anklagen. Aber wir müssen uns dekolonialisieren.
Wie sind Sie sich selbst auf die Schliche gekommen, dass rassistische Denkmuster zu Ihnen gehören?
Marita Wagner: Ich glaube, durch kritische Anfragen von Kommiliton:innen, die nicht böse gemeint waren, aber die mir gewisse Grenzen in meinem Denken aufgezeigt haben. Ich erinnere mich an ein Gespräch 2015 mit dem Schwarzen Professor Vuyani Vellem, einem der Gründerväter der Schwarzen Befreiungstheologie. Das war für mich ein wichtiger Schlüsselmoment. Auf meine Frage, was ich als weiße deutsche Theologin für ein gutes gesellschaftliches Miteinander tun könne, antwortete er: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so weiß ist, wie sie ist. Aber es wäre deine Mitschuld, wenn sie so bleibt.“ Er hat mich nicht verurteilt, dass ich weiß bin, sondern er hat die Strukturen verurteilt, unter denen ein bestimmter Teil der Gesellschaft bis heute zu leiden hat. Er hat mir deutlich gemacht, dass mein Einsatz für eine solidarischere Welt meine Verantwortung ist. Dann habe ich gefragt: „Aber was kann ich tun?“ Er sagte nur: „Gerechtigkeit.“ Erst im Nachhinein ist mir die Bedeutung dieses Gesprächs klar geworden, ebenso, was er im Unterricht versucht hat, uns zu vermitteln. Es war natürlich provokant, dass er das Weißsein benannt hat und gesagt hat, dass daraus solch ein Leid hervorgegangen ist. Aber es ging ihm nicht darum, die weißen Menschen zu verurteilen. Seine Frage war vielmehr, wie wir neues Vertrauen untereinander schaffen können, ein miteinander Leben und Glauben sowie eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Sie beschäftigen sich wissenschaftlich mit Rassismus. Welche Dinge stellen Sie in Bezug auf die deutsche Gesellschaft fest?
Marita Wagner: Ich glaube, wir sind gerade in einer Art Umbruchsituation. Ganz lange war das Thema tabu. Doch ich glaube, das ist jetzt aufgebrochen, tragischerweise durch den Mord an George Floyd in den USA. Meiner Wahrnehmung nach ist gerade die jüngere Generation auf der Suche nach neuen Konzepten, wie wir respektvoll miteinander leben können. Ich unterrichte junge (Theologie-)Student:innen in Aachen und Salzburg und kann dort beobachten, dass diese unheimlich politisch sensibilisiert sind. Sie fragen nach rassistischen Strukturen auch im theologischen Lehrplan, aber auch die Gender-Debatte wird sehr heiß debattiert. Nicht konfrontativ, sondern konstruktiv-produktiv im Sinne von, eine politische Stimme zu finden und gemeinsam etwas bewegen zu wollen. Das finde ich sehr inspirierend und es gibt mir viel Hoffnung. Da merke ich auch, die Kirche ist nicht tot. Da passiert ganz viel.
Wie lassen sich unbewusste rassistische Denk- und Handlungsmuster überwinden?
Marita Wagner: Es braucht einen langen Atem. Und was mir persönlich sehr hilft, sind Gesprächsforen. Gerade in der Corona-Zeit gab es sehr viele digitale Angebote, wo es möglich war, über eigene Rassismen ins Gespräch zu kommen. Da entstehen für mich Räume, wo Unsicherheiten offen miteinander diskutiert werden können. Das Thema ist sehr komplex, es geht um unsere Identität, unser eigenes Ich-Empfinden und es kann schwerfallen, sich auf dieses Thema einzulassen. Das verstehe ich. Es entwickelt sich ein neues Sprachsystem, neue Begrifflichkeiten. Wenn gewohnte Koordinaten wegfallen, löst das erst mal Verunsicherung aus. Gerade deshalb finde ich es so toll, diese Plattformen zu haben, wo man auch mit Fragen kommen kann. Ich kann von und mit anderen lernen und merke, dass ich nicht alleine auf diesem Weg bin. Was mir auch hilft, sind andere weiße junge Menschen in meinem Umfeld, die sich mit dem Thema beschäftigen und mich vielleicht auch darauf hinweisen, wenn ich etwas sage, was problematisch ist. Also auch das ist wichtig, dass wir uns als privilegierte weiße Menschen gegenseitig daran erinnern, wenn wir wieder in alte Denkmuster verfallen.
Interview: Elfriede Klauer, In: Pfarrbriefservice.de
Marita Wagner (geb. 1992) studierte katholische Theologie in Frankfurt am Main und in Pretoria in Südafrika. Sie arbeitet als Referentin für Weltkirche und Pastoral beim katholischen Hilfswerk „missio“ in Aachen und ist Chefredakteurin des theologischen Fachmagazins Forum Weltkirche. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Themen Postkolonialismus, deutsches Kolonialerbe und Rassismus.
Datei-Info:
Dateiformat: .rtf
Dateigröße: 0,02 MB
Sie dürfen diesen Text für alle nichtkommerziellen Zwecke der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pfarr-/Gemeindebrief, Plakat, Flyer, Website) sowie für Unterrichtszwecke* nutzen. Die Nutzung ist in dem beschriebenen Rahmen honorarfrei. Sie verpflichten sich den Namen des Bildautors/-in, als Quelle Pfarrbriefservice.de und ggf. weitere Angaben zu nennen.
*) Ausführliche Infos zu unseren Nutzungsbedingungen finden Sie hier.
Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegs an die Redaktionsanschrift.
Beispiel für den Urhebernachweis, den Sie führen müssen, wenn Sie den Text nutzen
Text: Elfriede KlauerIn: Pfarrbriefservice.de