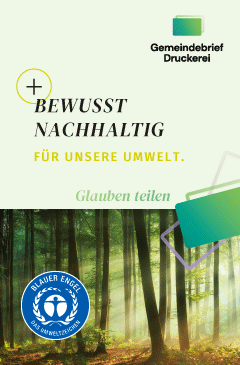Die (Pfarr-)Gemeinde als die bislang privilegierte kirchliche Standard-Sozialform gerät mehr und mehr unter Druck: Sie muss sich den Vorwurf gefallen lassen, immer mehr um sich selbst zu kreisen und nur noch wenige Milieus anzusprechen. Die Orientierung am Evangelium fordert die Gemeinden zu Kreativität und Veränderungen auf. Hildegard Wustmans, Professorin für Pastoraltheologie an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz, plädiert für die Notwendigkeit von Ortswechseln, aber auch von Habituswechseln. Statt der Fixierung auf die gemeindlichen Befindlichkeiten und alles, was fehlt, sollte der Blick darauf gelenkt werden, was der Kirche an neuen Orten und von bislang unerhörten Minderheiten an Talenten zugeführt werden könnte. Ein zukunftsfähiges Modell ist nach Ansicht der Autorin das Denken und Arbeiten in einem gemeindeübergreifenden Netzwerk. Der Text ist im Magazin für missionarische Pastoral, εὐangel, 2011 erschienen.
Eine Familie zieht um. Die neuen Nachbarn, zumindest ein Teil von ihnen, sind in der Pfarrgemeinde aktiv. Kaum sind die Umzugskisten ausgeladen, stellen sie sich freundlich vor. Und nicht nur das, sie werben sogleich für ihre Pfarrgemeinde und die verschiedenen Aktivitäten: den Kirchenchor, die Kindergruppe, den Bibelkreis und das Frühstück nach dem Familiengottesdienst. Und unmissverständlich wird auch klar, wer sich an diesem Ort wirklich beheimaten will, sollte sich auch in der einen oder anderen Weise am Gemeindeleben beteiligen. Allein die Neuhinzugezogenen werden nicht nach ihren Wünschen oder Vorerfahrungen befragt. Dass die Pfarrgemeinde schon das Richtige ist, wird einfach als Tatsache behauptet.
Nur wenige kommen
Ein weiteres Beispiel: Haupt- und Ehrenamtliche einer Pfarrgemeinde fragen sich, warum sie immer nur die gleichen Personen und dabei vor allem Senioren/-innen und Familien ansprechen. Das Angebot ist vielfältig, eigentlich müsste für jeden/jede etwas dabei sein. Es gibt natürlich Familien- und Seniorengottesdienste, in unregelmäßigen Abständen auch einen Jugendgottesdienst, aber der Zulauf ist nicht groß. Im Gegenteil, die Zahl der Gottesdienstbesucher/-innen geht insgesamt langsam, aber merklich zurück. Neuzugezogene sieht man kaum und junge Leute eigentlich so gut wie nicht. Ein Lichtblick sind da die Familiengottesdienste, die einmal im Monat stattfinden, da kommen dann mehr.
Mit einem Blick von außen
Vor diesem Hintergrund beschließen die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde (Pfarrer, pastorale Mitarbeiter/-innen und Pfarrgemeinderat), sich bei einer Klausur diesen Fragen zu stellen. Mit einer externen Begleitung vereinbaren sie als ersten Schritt den Blick von außen. Der Referentin werden zur Vorbereitung diverse Mitteilungsblätter und Flyer zugänglich gemacht und die Homepage genannt. Und was fällt auf?
Wenig einladend
Bei dem Pfarrblatt von St. Martin, so nennen wir die Pfarrgemeinde einmal, fällt der „Kopf“ ins Auge. Hier wird der Blick zuallererst auf die Bankverbindung gelenkt. Danach erst ist zu lesen, wann das Pfarrbüro geöffnet ist und wer die Ansprechpartner sind. Der Blick geht dann gleich nach unten zu dem Bildchen „Ans Danken denken“. Dieser appellative Satz wirkt bemüht. „Oben“ wird auf das Geld verwiesen und „unten“ steht der Dank als Appell. Der gut gemeinte Hinweis kommt nicht gut an.
Bei den Terminhinweisen wird eindeutig das Signal gesendet: Was bei uns geschieht, ist der Leserin, dem Leser ohnehin schon bekannt und im Grunde selbstverständlich. Man versteht das alles, wenn man dazugehört bzw. sich in der Kirche und ihren Untergliederungen auskennt. Wer jedoch so Termine bekannt gibt, kann „Neue“ nicht wirklich ansprechen, es fehlen wesentliche Erklärungen und Hinweise.
Angebote – für wen?
Darüber hinaus sind die Angebote am Lebenslauf der Normalbiografie ausgerichtet: Es gibt etwas für die Senioren, für die Ministranten/-innen, für die älteren Frauen und Mütter und ihre Kinder oder bei Kolping. Aber was gibt es für Singles und Vollerwerbstätige, z. B. unter den Frauen? Die Angebote belegen, dass sich die Struktur des Sozialraums Gemeinde an dem Wahrnehmungsmuster des Normal-Lebenslaufs orientiert. Allerdings ist dieser Normal-Lebenslauf in einigen Regionen schon längst nicht mehr die Regel1.
Abschreckende Wirkung
Auffallend viele Tippfehler in den Pfarrbriefen vermitteln den Eindruck, dass das alles in Eile und damit mit wenig Achtsamkeit erstellt worden ist. Zitate und fromme Sprüche finden sich als Füllmaterial. Ähnlich verhält es sich mit den typischen Pfarrbrief-Bildchen. Wer fühlt sich davon wirklich angesprochen? Was sagen diese Bilder? Welche Aufgabe haben sie? Sollen sie Inhalte visuell verstärken oder Lücken füllen? Gerade an diesen Punkten zeigt sich auch die bisweilen abschreckende Wirkung der typischen Pfarrbriefgestaltung. Es kann fatale Folgen haben, wenn die ästhetische Dimension der „Auftritte“ unterschätzt oder gar abgewertet wird nach dem Motto „Alles nur Schein, es kommt auf die Inhalte an“2.
Gesprächsbereit?
Im Pfarrbrief von St. Martin findet sich auch ein Hinweis, dass es gesprächsbereite Menschen gibt. Man fragt sich, gesprächsbereit wofür? Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Beratung, Therapie …? Und dann gibt es da auch noch Menschen, die sich um die „Neuen“ kümmern wie um die Alten und Kranken. Sind die „Neuen“ eine Problemgruppe? Allerdings stellen sich jene, die sich um die „Neuen“ kümmern, bezeichnenderweise selber im Pfarrbrief nicht vor. Will man mit ihnen in Kontakt kommen, muss man sich erst an das Pfarrbüro wenden. Aber würde ich das tun? Nein. Es wäre mir zu umständlich. Ich würde mir gerne im Vorfeld ein „Bild“ von dem Gesprächspartner/der Gesprächspartnerin machen. Insgesamt wäre es mir die Sache wohl einfach nicht wert.
Vielfältige Gemeinden
Sicherlich, das sind selektive Blitzlichter, und es ist gewiss, dass es auch gelungene Beispiele der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Pfarrgemeinden gibt. All das belegt aber auch, dass wohl kaum von der Gemeinde zu sprechen ist. Die Gemeindewirklichkeit sieht vielmehr an jedem Ort anders aus. Darüber hinaus hängt es auch von den Lebensumständen und Einstellungen der Menschen ab, ob sie sich in Pfarrgemeinden beheimaten können und wollen.
Inhaltliche Bindung an die Pfarrfamilie
Und dennoch sagen die Beispiele etwas über den allgemeinen Zustand einer Vielzahl von Gemeinden – man bemüht sich, auf Andere zuzugehen, ist aber inhaltlich noch immer an das gebunden, was in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Hochkonjunktur feierte: die Pfarrfamilie. „Die Gemeindetheologie 1970 war der Versuch, in Zeiten der beginnenden Freisetzung zu religiöser Selbstbestimmung auch von Katholikinnen und Katholiken die katholische Kirche von einer amtszentrierten Heilsinstitution zu einer quasi-familiären gemeindlichen Lebensgemeinschaft umzuformatieren. […] Die gemeindetheologische Modernisierung der Nachkonzilszeit wollte freigeben (‚mündiger Christ‘) und gleichzeitig wieder in der ‚Pfarrfamilie‘ eingemeinden. Sie wollte Priester und Laien in ein neues gleichstufiges Verhältnis bringen – bei undiskutierbarem Leitungsmonopol des priesterlichen Gemeindeleiters. Sie wollte eine Freiwilligengemeinschaft sein, die aber auf ein spezifisches Territorium bezogen sein sollte, sie wollte für alle da sein, war es doch für immer weniger“3.
Mit sich selbst beschäftigt
Dies attestiert auch Rolf Zerfaß bereits 1986 in einem Artikel4. Er hält fest, dass Gemeinden vielfach keine Lernorte des Glaubens sind, sondern mehr und mehr Orte „eines beklemmend unpolitischen Bewußtseins und einer mitunter erschreckenden Selbstherrlichkeit (besonders gegenüber Gescheiterten, Geschiedenen, Fernstehenden oder solchen, die nicht glauben können)“5. Zerfaß beschreibt Gemeinden als Orte „beharrlichen Kreisens um sich selber, um den Kirchturm, das Pfarrfest und die wenigen Personen, die derzeit (und wie lange schon?) im Pfarrgemeinderat das Sagen haben“6.
Sich als Gemeinde neu erfinden
Und Rainer Bucher stellt Jahrzehnte später ähnliche Anfragen an die „Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsstrukturen“7 von Gemeinden. Dabei geht es für die Gemeinden nicht mehr darum zu fragen: „‚Wie lebendig sind wir?‘, sondern: ‚Wen schließen wir eigentlich aus?‘“8, nicht zu fragen: „Wie halten wir unsere Sozialformen am Funktionieren?“9, sondern: „Wofür gibt es sie [die Gemeinden; HW] eigentlich und wie müssen sie sich vielleicht ändern, um ihre Aufgabe heute erfüllen zu können?“10 Und so kommt er zu dem Schluss, dass „sich die ‚die Gemeinde‘ permanent ‚neu erfinden‘“11 muss. „Sie muss immer wieder definieren: Was bedeutet das Evangelium hier und was das Hier und Heute für das Evangelium? Und vor allem: Welche institutionelle Form muss ich hier und heute eigentlich haben, um diese Aufgabe zu erfüllen?“12
Nur wenig Mut für neue Wege
Dass diese Fragen noch immer zu stellen sind und dies auch angesichts der Erkenntnisse der Sinus-Milieu-Studie13 und ihrer Fortführungen, zeigt, welch ein „Sozialformkonservatismus“14 de facto anzutreffen ist. Allerdings kann man gegenwärtig schon den Eindruck haben, dass die privilegierte kirchliche Sozialform Gemeinde, wie die Institution Kirche im Gesamten, seit geraumer Zeit mehr und mehr unter Druck gerät15. Die Entwicklungen zeigen, dass die Formen, wie Kirche sich und auch Religion strukturiert, immer weniger greifen. Es ist nicht mehr zu leugnen, dass es erhebliche Veränderungen im „religiösen Feld“16 gegeben hat und dass nur bedingt Mut vorhanden zu sein scheint, neue Wege in der Pastoral zu gehen.
Pastoralorientiert handeln
Vieles, was getan und geplant wird, erscheint im Modus des Bekannten und der vertrauten Sozialformen. Dabei wäre es an der Zeit, nicht mehr sozialformorientiert, sondern pastoralorientiert zu handeln und dabei sozialformkreativ zu werden17. Es geht dabei um nicht weniger als um die Umsetzung des ersten Satzes der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi, und es findet sich nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen Widerhall fände.“ Diesen Satz ernst zu nehmen, hätte zur Konsequenz, in Orte zu investieren, sie zu stärken, von ihnen zu lernen und einen Perspektiven- und Paradigmenwechsel zu vollziehen: Statt der Fixierung auf die gemeindlichen Befindlichkeiten und alles, was fehlt, wäre der Blick darauf zu lenken, was der Kirche an neuen Orten und von bislang unerhörten Minderheiten an Talenten zugeführt werden könnte.
Bekannte Orte verlassen
Dies bedeutet in urbanen Kontexten, den Mut zu haben, an konkreten Orten auf Profile zu setzen, wie dies z. B. in Jugendkirchen, christlichen Zentren für Meditation und Spiritualität, Klöstern und in der Citypastoral geschieht. Aber das allein reicht nicht. Es gilt darüber hinaus, das Wagnis einzugehen, bekannte Orte zu verlassen und mit Menschen an neuen Orten die Bedeutung des Evangeliums zu entdecken. Dies hat dann nicht nur Ortswechsel zur Konsequenz, sondern es erfordert auch einen Habituswechsel.
Der Begriff des Habitus
Der Begriff des Habitus wurde von Pierre Bourdieu geprägt18. „Die soziale Lage der Individuen, die sich in ihrem Klassenhabitus ausprägt, manifestiert sich in der äußeren Erscheinung, in den Moralvorstellungen, im ästhetischen Empfinden und im Umgang mit den Produkten der Kulturindustrie – sie äußert sich im Geschmack.“19 Und in Zeiten des Mangels wird dieser Geschmack zu einem „Notgeschmack, der eine Art Anpassung an den Mangel einschließt und damit ein Sich-in-das-Notwendige-fügen, ein Resignieren vorm Unausweichlichen“20.
Mangelverwaltung statt Kreativität
Dieses „Sich-in-das-Notwendige-Fügen“ wird auch in den unterschiedlichsten kirchlichen Maßnahmen zur Mangelverwaltung deutlich und zeigt sich besonders darin, dass pastorale Räume um den Priester herum und von ihm her gebildet werden. „Der Priester wird damit zur entscheidenden Variable der territorialen Versorgung des pastoralen Raumes. Bildlich gesprochen: er wird von der Organisation wie ein einzelner Leuchtturm in das Dunkel installiert, dessen orientierendes Licht in immer weitere Fernen zu leuchten hat.“21 So kann man natürlich auf den (Personal-)Mangel reagieren, aber es wird letztlich wohl zu kurz greifen, weil nur im Modus des Bekannten agiert wird. Dies wird den Trend nicht umkehren und führt zu einer allgemeinen Überforderung, nicht zuletzt der Priester.
Pastorale Netzwerke
Eine Möglichkeit, kreativ mit der Situation des Mangels umzugehen, liegt in den verstärkten Bemühungen, Pastoral in Netzwerken zu gestalten und damit neue Wege in der Pastoral zu beschreiten22. Dabei ist die Arbeit in Netzwerken zugleich Ausdruck eines neuen Habitus und eines intensiven Kapitaleinsatzes, der nicht ökonomisches Kapital meint, sondern gerade auch kulturelles und soziales Kapital in den Blick nimmt23. Arbeit im Netzwerk verlangt den Akteuren ab, dass sie eingefahrene Mentalitätsmuster überwinden und die Beziehungen der kirchlichen Orte untereinander und zu gesellschaftlichen Orten neu formatieren24.
Von der Vielfalt profitieren
Dies führt unweigerlich zu gegenseitigen Relativierungen und zu einer neuen Wahrnehmung von anderen Orten: Man kann von der Vielfalt im Raum profitieren. Zudem wird im Rahmen der Netzwerkarbeit das Handlungsmuster widerlegt, „Großräume seien ungeeignet für vitale Pastoral“25. Allerdings kommen den einzelnen Gemeinden in einem Netzwerk andere Bedeutungen zu. Sie sind „in diesem Netz die niedrigschwellige, kontaktfreudige und leicht identifizierbare Basisstruktur“26. Damit ist angezeigt, dass es nicht mehr um die Gemeinde als vertraute Größe, eingeschworene Gruppe und Pfarrfamilie geht, sondern um die Vielfalt und die gegenseitige Bezugnahme von verschiedenen Orten, die für kreative Neuansätze im größeren Raum genutzt werden kann und soll27.
Sich ergänzen und arbeitsteilig kooperieren
Der Schlüssel liegt in einem neuen Verhältnis zueinander – in wechselseitiger Ergänzung und arbeitsteiliger Kooperation. „Es käme darauf an, dass die kirchlichen Orte und ihr Personal in freier Selbstverpflichtung miteinander kooperieren, sich als Teil eines pastoralen Verbundes innerhalb eines sozialen Nah- und Regionalraums (aber auch darüber hinaus) verstehen und immer weiter entwickeln. Eine solche Kooperation beginnt bereits mit einer Verbesserung der regelmäßigen und wechselseitigen Information, des konkurrenzlosen Über-sich-hinaus- und Auf-einander-Verweisens und des regelmäßigen Sich-Abstimmens. Diese Kooperation kann gesteigert werden durch gewählte (und in der Regel zeitlich begrenzte) gemeinsame Projekte, wenn es sinnvoll ist, Kräfte zu bündeln, und durch Arbeitsteilung unter den Pfarrgemeinden, zwischen ihnen und anderen kirchlichen Orten; denn nicht jeder muss allen alles werden. Arbeitsteilung und Vernetzung sind – neben Zielorientierung – wichtige Kooperationsprinzipien: Was A macht, muss nicht B, was B und A machen, muss nicht C verdoppeln usw.“28
Für ein charismatisches Netzwerk-Wir
Wer sich auf die Zusammenarbeit im Netzwerk einlässt, wird erfahren, dass der eigene Standort an Profil gewinnen kann, weil kontextgebundene Schwerpunktsetzungen nun leichter möglich sind. Dadurch entsteht im wahrsten Sinn des Wortes Vielfalt, und es ergeben sich Chancen und Möglichkeiten, Milieus zu erreichen, die sich von den gewohnten Sozialformen und Angeboten nicht angesprochen fühlen. „Mit der Zeit wird dann möglicherweise der zentrale Bezugspunkt der Pastoral nicht mehr vorzugsweise die einzelne Pfarrgemeinde sein, an der nur noch Minderheiten unter den Kirchenmitgliedern hängen, sondern ein neues charismatisches Netzwerk-Wir mit einem breit gefächerten Panorama von Gemeinschaften, Initiativen und Angeboten, die jeweils über sich hinaus und gegenseitig aufeinander verweisen und – was in aller Vielstimmigkeit wichtig ist – konzentriert sind.“29
Für eine Verkündigung des Evangeliums heute
All das geschieht jedoch nicht um seiner selbst willen, sondern angesichts der Tatsache, dass es der Kirche um die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute geht. Kirche ist kein Selbstzweck30. Und im Rahmen der Welt von heute gilt es, dass das, was sinnvollerweise zu tun ist, nicht mehr alleine bewerkstelligt werden kann. Man braucht Partner/-innen, und das ist gut so. „Man gibt den Anspruch auf, ein Zentrum errichten zu wollen, Netzwerke agieren dezentral; ihre Vitalität entsteht aus den Zellen, die sich selbst organisieren, dann aber auf das Ganze des Netzes beziehen.“31 So werden Nullsummenspiele, falsche Konkurrenz und die Monopolisierung von Sozialformen und Praktiken überwunden.
Herausforderung für bekannte Formen
Im Netzwerk ist es möglich, Orte der Begegnung und der Nähe, der Einkehr und des Gebetes, der Dienstleistung und der Hilfe, des Festes und der Freude miteinander zu verbinden, ihnen ihren Raum und ihre Zeiten zu lassen und darin die Vitalität des Glaubens zum Ausdruck zu bringen32. Damit werden die bekannten Formen nicht gleich zum alten Eisen gelegt, aber sie werden unweigerlich herausgefordert, und dies mit weit reichenden Konsequenzen: Man erkennt, dass man nicht der Nabel der Welt ist und dass es auf vielfältige Kontakte im sozialen Raum ankommt. Und das wiederum erfordert es, die eigenen Stärken zu kennen und diese selbstbewusst ins Spiel zu bringen.
Neue Kontaktmöglichkeiten
Aber damit allein ist es nicht getan, es braucht ein echtes Interesse an anderen Akteuren, ihre Stärken sind anzuerkennen, und von ihnen ist zu lernen. So können neue Orte erschlossen werden, ohne zugleich alles aufgeben zu müssen. Und es wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Menschen sich nicht mehr automatisch „eingemeinden“ lassen wollen33. Aber Orte, an denen drinnen und draußen fließend sind, bieten neue Kontaktflächen34. Neuzugezogene wird man dann nicht gleich für den Kirchenchor gewinnen wollen, es gäbe nicht nur die pfarrlichen Angebote, sondern auch interessante Schnittstellen zu Akteuren aus den unterschiedlichsten kirchlichen und sozialen Bereichen und für Menschen immer wieder die Möglichkeit, vorbeizuschauen, mitzumachen, zu genießen und weiterzugehen.
Hildegard Wustmans
Quelle: Magazin für missionarische Pastoral, εὐangel 2 (2011), Heft 1, www.kamp-erfurt.de/
_______________________________________________
1 Vgl. Rainer Bucher, Jenseits der Idylle. Wie weiter mit den Gemeinden? In: Ders. (Hg.), Die Provokation der Krise. Zwölf Fragen und Antworten zur Lage der Kirche. Würzburg 2004, 106–124: 107.
2 Vgl. zu diesem Gesamtkomplex Michael N. Ebertz/Bernhard Wunder (Hg.), Milieupraxis. Vom Sehen und Handeln in der pastoralen Arbeit. Würzburg 2009.
3 Rainer Bucher, 1935-1970-2009. Ursprünge, Aufstieg und Scheitern der „Gemeindetheologie“ als Basiskonzept pastoraler Organisation der katholischen Kirche. In: Lucia Scherzberg (Hg.), Gemeinschaftskonzepte im 20. Jahrhundert zwischen Wissenschaft und Ideologie. Münster 2010, 289–316: 314f.
4 Vgl. ebd. 315.
5 Rolf Zerfaß/Klaus Roos, Gemeinde. In: Gottfried Bitter/Gabriele Miller (Hg.), Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe. Bd. I. Munchen 1986, 132–142: 133.
6 Ebd.
7 Bucher 2004, 126.
8 Ebd.
9 Ebd. 128.
10 Ebd.
11 Ebd.
12 Ebd.
13 Carsten Wippermann/Isabel de Magalhaes, Zielgruppen-Handbuch. Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus® 2005. Eine qualitative Studie des Instituts Sinus Sociovision zur Unterstützung der publizistischen und pastoralen Arbeit der Katholischen Kirche in Deutschland im Auftrag der Medien-Dienstleistung GmbH und der Katholischen Sozialethischen Arbeitsstelle. Heidelberg 2005.
14 Bucher 2004, 128.
15 Dies belegen die seit Jahren zurückgehenden Zahlen von Gottesdienstbesuchern/-innen, die Kirchenaustritte und die Bemühungen, die Versorgung der Gemeinden bei weniger werdenden Priestern zu gewährleisten. Vgl. Matthias Sellmann, Weltpriester: die gegenwärtig riskierteste Großberufung in der Kirche. In: Lebendige Seelsorge 61 (2010) 99–105: 101 und ebenso die Ausführungen von Hans-Joachim Sander zur Religions- und Pastoralgemeinschaft in: Ders., nicht ausweichen. Die prekäre Lage der Kirche (Glaubensworte). Würzburg 2002.
16 Vgl. Pierre Bourdieu, Das Lachen der Bischöfe. In: Ders., Religion (Schriften zur Kultursoziologie 5). Konstanz 2009, 231–242; ders., Die Auflösung des Religiösen. In: Ebd. 243–249.
17 Vgl. Rainer Bucher, Die Neuerfindung der Gemeinde und des Pfarrgemeinderates. In: Lebendige Seelsorge 55 (2004) 18–22: 22 (= Bucher 2004a).
18 Vgl. Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a. M. 1987, 278 f.
19 Beate Krais/Gunter Gebauer, Habitus. Bielefeld 32010, 37.
20 Bourdieu 1987, 585.
21 Sellmann 2010, 101.
22 Vgl. Matthias Sellmann, Von der „Gruppe“ zum „Netzwerk“. Große pastorale Räume als Chance für eine durchbrechende Vielfalt kirchlicher Sozialformen. In: Anzeiger für die Seelsorge 119 (2010) 3, 19–23 (= Sellmann 2010a); Christian Bauer, Von der Pfarrei zum Netzwerk? Eine pastoralsoziologische Probebohrung. In: Diakonia 40 (2009) 119–126; Helmut Eder, Vom Gemeinde-Netz zum Netzwerk Gemeinde. In: Georg Ritzer (Hg.), „Mit euch bin ich Mensch …“ (FS Friedrich Schleinzer). Innsbruck 2008, 78–91.
23 Vgl. Pierre Bourdieu, Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Reinhard Kreckel (Hg.), Soziale Ungleichheiten. Gottingen 1983, 183–193.
24 Vgl. Sellmann 2010a, 22.
25 Ebd. 20.
26 Bucher 2004a, 20.
27 Vgl. Michael Hochschild, Religion in Bewegung. Zum Umbruch der Katholischen Kirche in Deutschland. Münster 2001, 101–113.
28 Michael Ebertz, Gesellschaftlicher Wandel der Kirche. In: Theologie und Glaube 100 (2010) 319–343: 341.
29 Ebd.
30 Vgl. Rainer Bucher, Die pastorale Konstitution der Kirche. Was soll Kirche eigentlich? In: Ders. (Hg.), Die Provokation der Krise. Zwölf Fragen und Antworten zur Lage der Kirche. Würzburg 2004, 30–44: 31.
31 Sellmann 2010a, 22.
32 Vgl. ebd. 23.
33 Vgl. Hans-Joachim Hohn, Gegen-Mythen. Religionsproduktive Tendenzen in der Gegenwart. Freiburg – Basel – Wien 1994, 140.
34 Vgl. ebd. 137.